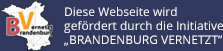von Max Hobrecht
1.
Bei meinem Hause steht ein Lindenbaum,
Es ist der letzte Baum in unserer Straße -
Vor Zeiten war’s wohl Brauch, dass jedermann
Vor seiner Türe solchen Hausgeist pflanzte,
Als Wetterdach, als luft’gen Sonnenschirm,
Darunter man zur Feierstunde saß,
Als Sommerhaus für Spaß und Meisenvolk,
Als grünes Freundschaftszeichen für den Fremdling,
Als - Gott weiß was? Genug, es war ein Band,
Dass dieses Haus mit Gott und Welt verknüpfte.
Als ich in dieser Straße Anker warf,
Gab’s nur mehr vier dergleichen Ueberständer.
Birnbäume waren drei - da weiß man doch,
Wozu die da sind: kam der Herbst herbei
Und färbten gelblich sich die ersten Früchte,
Begann der Kampf ums Recht, der Kampf ums Dasein:
Als Wurfgeschoss aus böser Buben Hand
Flog Stein und Knittel in die grüne Krone,
Mit dem herabgeschlag’nen Blätterschmuck
Fiel manche Frucht vorzeitig in den Sand.
Nicht um zu feiern, saß der Hausherr da -
Als grimmer Wächter ging er seine Runden,
Allnächtlich fuhr er auf aus tiefem Schlaf:
War es der Wind, der an den Zweigen zerrte,
War’s Diebesband? Verdammt die Finsternis!
Es kann der Beste nicht in Frieden leben –!
Der Best doch vielleicht, ein Birnbaum nicht,
Zumal nicht an der Straße - so geschah’s,
Dass ihrer drei mit eins der Art erlag
Und in den Ofen kroch - die Linde blieb.
2.
Die Linde blieb - bald zählt sie hundert Jahr;
Dass alte Haus, daran man sie gepflanzt,
Ward abgebrochen, an die Stelle dann
Ein neues Haus gebaut - die Linde blieb.
Man hat ihr manchen guten Ast genommen,
Auch an der Wurzel hat man sie gerührt,
Die Sauger mussten sich dem Grundbau fügen,
Der Stamm ward aus dem rechten Lot gedrängt,
Sie krankte wohl, allein sie überwand,
Und ihre Krone, seitwärts nun geneigt,
Wirft wieder breiten Schatten auf die Straße,
Webt meinen Saal in einen grünen Dämmer
Und streift das Fenster meines Schlafgemachs
Mit Blütenzweigen, wenn der Sommer kommt.
Das Haus, wie einst das alte, steht am Tor;
Der inn’re Winkel, draus die Linde steigt,
Ist so ein rechter Platz für müß’ge Leute,
Für trauliches Geschwätz und stilles Sinnen.
Wie einst der Weibel mit dem Torwart hier,
Kann jetzt der Nachbar mit dem Nachbarn sitzen
Und Ueberlief’rung pflegen ohne Müh -
So dacht’ ich und, wie man der Windenblume
Ein Stäbchen, dass sie dran sich ranke, steckt,
Wie man dem Kürbis leichte Fäden zieht,
Dass er dran klettert in Gelehrigkeit,
So ließ ich einen Feldstein, der, vom Bau
Zurückgeblieben, noch im Hof mir lag,
Weil sich kein Ort, ihn zu verwenden, fand,
Zur Linde wälzen, an den Stamm ihn lehnen,
Als wollt’ ich sagen: Freunde, setzt euch drauf!
3.
Im Plaudereck am Tor die alte Linde,
Der Feldstein drunter, wie zum Sitz gemacht,
Ein rechtes Bild - und nun noch Leben drauf:
Die Botenfrau mit abgesetztem Korb,
Die Magd, die barfuß hier zum Jahrmarkt kam
Und erst mit Strumpf und Schuh sich städtisch putzt,
Der Nachbar Schuster mit dem Rausch von gestern,
Der gerne Vortrag hält vor müß’gem Volk,
Und was sich sonst vor diesen Fenstern zeigt -
Man bleibt doch jung, gottlob, trotz grauem Haar!
Zwar, wenn ich gestern einen Kern mit legte,
Geh ich nicht heut schon nach dem Pflänzchen sehn -
Nach jenem Stein hab’ ich doch oft geschielt
Und immer öfter, ward gar ungeduldig,
Dann ließ ich’s sein - kein Mensch saß jemals drauf!
Unheimlich blieb er - selbst der Affenpintscher
Des Nachbars drüben kam voll Misstraun nur
Und gab dem Misstraun den geläuf’gen Ausdruck:
Auch seine Freunde fanden dann sich ein -
Mein eigner Köter fehlte nicht darunter -
Dem Griechenchor gleich kreisten ernsthaft sie
Um den Altarstein, blieben wieder stehn
Zu glücht’gem Opfer und verzogen sich.
Am Ende ward das Wesen gar zum Spuk:
Die aus dem nächsten Wirtshaus vor dem Tor
Nach Hause trollten um den Hahnenschrei,
Bierfrohe Jugend, hatten was gebraucht,
Die Kraft zu üben, uns so ward, den Stein
Herumzurollen gleich dem Sisyphus,
Ein Fest für jetzt und blieb’s für lange Zeit.
In mancher Nacht, wenn mir der Schlaf nicht kam,
hört’ ich das polternde Geräusch des Steins -
Und früh am Morgen war er auf dem Platz.
Die Nachbarn haben endlich sich beklagt -
Da ließ ich stille meinen Stein verschwinden.
4.
So schlug mein Plan, der Welt zu dienen, fehl,
Wie fein er auch erdacht und ausgeführt.
Und wo ich, nach des Dänenprinzen Art,
Vor lauter Ueberlegen nicht getan,
Geriet mein Nichttun wunderbar zum Guten.
Ein starker Ast, der mich bei Bau gestört,
War meiner guten Linde weggenommen;
Das weiche Holz mit grober, bast’ger Rinde
Gab keinen glatten, saubern Schnitt am Stamm,
Voll Runzeln blieb die Narbe, drin das Nass
sich sammelte von Regen oder Schnee;
Allmählich nahm die Fäulnis ihren Weg
Ins Innere, und weit und weiter gähnte
Der schwarze Mund des ganz gemeinen Astlochs.
Hier ist ein Fall, so sprach ich zu mir selbst,
Wo man durch einen Pflock die Höhle schließt
Mit guter Wirkung - besser ist es noch,
Man füllt sie ganz mit einem derben Teig
Aus Lehm und Schlacke, oder - Kohlenstaub?
Darüber ein geteerter Leinwandfleck -
Auch wohl ein Blech mit Rinnen für die Nässe?
Kurz, immer weiter griff die Phantasie
Und - tiefer ward und dunkler nur das Loch
Und immer stärker Zweifel und Bedenken.
Im Frühling war’s, erst halb entwickelt nur
Das junge Laub, die Krone meines Baums
Durchsichtig noch, vom Sonnenlicht durchflossen;
So nahm ich leicht der neuen Gästen wahr,
Die im Gezweige dort ihr Wesen trieben,
Nicht Spatz, nicht Meis’, noch Fink - von größrer Art
Und voller Leben und Beweglichkeit:
Ein Starenpaar! Die hatten bald bemerkt,
Was ihnen dienlich, und die Kreuz und Quer
Durchforschten sie das Loch und fuhren aus
Moder und faules Holz recht wie die Stärrner.
Schon andern Tags ward mir die Wirtschaft klar:
Er saß in luft’ger Höh’ auf schwankem Zweig
Und sang und pfiff, ein ganzer Kavalier;
Sie steckte tief im Loch in Hausstandssorgen,
Strohhalme, Federn sah man sich bewegen,
Sie selbst blieb unsichtbar für lange Zeit.
Und wie von Tag zu Tag das Laub sich mehr
Ins Breite legte und zusammenschloss,
So schob sich eine Wand von grünen Schirmen
Zwischen die Welt und diese Wochenstube.
- Ob ich das Astloch wohl im nächsten Jahr
Verstopfen werde? Nun - man wird ja sehn! -
5.
Zur Zeit der Heuaust, wenn die duft’ge Fracht
In schweren Fudern durch die Straßen fährt,
Ist meine Linde wie ein rechter Schlecker:
Sie streicht mit ihren langen grünen Fingern
Von jedem Wagen sich das Beste ab
Und nimmt den Zehnten sicher wie ein Pfaff.
Die heuer, die es angeht, lachen drob:
„Soviel muss übrig sein!“ ist Bauernsinn,
- Dem Leben fremd, Verschwenden eigen ist -
In Städten herrscht, sei Trojas Banner flog,
Der Ordnung strenger Geist und Bürgersinn,
Der ängstlich sorgt, dass jeder gleich Maß
Und keiner was erhält, das andre missen.
- Ließ sich der Sonnenstrahl in Stücke schneiden,
Es kriegte jeder seinen Viertelzoll -
Und allen ist’s das halbe Tagewerk,
Dem Nachbarn fleißig auf die Finger sehn.
´s ist nicht mehr Brauch, vorm Hause Bäume pflanzen,
Und viele - weiß ich - fühlen sich beengt
Von meinem Baum, der keinen doch im Wege.
Wenn auf den Steinen heiß die Sonne brennt,
Steht mancher gern im Lindenschatten still -
Die Röcke überm Kopf, und suchen Schutz -
Aufatmend stehn sie wohl und schwatzen dann,
- Von meinem Zimmer hör’ ich das Gemurmel -
Was reden sie? - „Wie’s doch nur kommen mag,
Dass hier der einz’ge Lindenbaum noch steht
Und ob’s wohl in der Ordnung? -„ aber halt!
Einsamer Grübler, wie verirrst du dich!
Nicht Bauern oder Bürger - Menschen sind’s,
Und mit den Maßen ihrer Zeit zu messen.
Einstmals wird Lindenpflanzen wieder Brauch
Und - Sitt’ und Brauch sind mächt’ger als die Liebe.

Kai vorm Haveltor mit der Linde dahinter
und dem Hobrechtschen Haus Havelstrasse Nr.17
1895
(Archiv Günter Thonke)

Hinterm Haveltor vor der Langen Brücke
mit der alten Linde am Hobrechtschen Haus
(Archiv Günter Thonke)